Der Schrecken und andere psychoanalytische Studien
Bookreader Item Preview
Share or Embed This Item
- Publication date
- 1929
- Topics
- Psychoanalyse, Psychoanalysis, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, International Psychoanalytic University Berlin, IPU
- Publisher
- Internationaler Psychoanalytischer Verlag
- Contributor
- International Psychoanalytic University Berlin / Antiquariat Urban Zerfaß zerfass@snafu.de
- Language
- German
- Rights
- Text made available in compliance with Section 108 (h) of the Digital Millennium Copyright Act of 1998.
1929, Internationaler Psychoanalyischer Verlag, Wien
- Addeddate
- 2010-12-22 12:49:20
- Identifier
- Reik_1929_Der_Schrecken_k
- Identifier-ark
- ark:/13960/t85h8bf92
- Ocr
- tesseract 5.2.0-1-gc42a
- Ocr_detected_lang
- de
- Ocr_detected_lang_conf
- 1.0000
- Ocr_detected_script
- Latin
- Ocr_detected_script_conf
- 0.9509
- Ocr_module_version
- 0.0.18
- Ocr_parameters
- -l deu
- Openlibrary_edition
- OL15092382M
- Openlibrary_work
- OL5354693W
- Page_number_confidence
- 62.19
- Pages
- 193
- Pdf_module_version
- 0.0.20
- Ppi
- 600
- Year
- 1929
comment
Reviews
There are no reviews yet. Be the first one to
write a review.
1,487 Views
DOWNLOAD OPTIONS
IN COLLECTIONS
The Collection Of The International Psychoanalytic University Berlin Additional Collections
Additional Collections 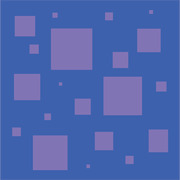
Uploaded by Arkadi Blatow on
 Live Music Archive
Live Music Archive Librivox Free Audio
Librivox Free Audio Metropolitan Museum
Metropolitan Museum Cleveland Museum of Art
Cleveland Museum of Art Internet Arcade
Internet Arcade Console Living Room
Console Living Room Books to Borrow
Books to Borrow Open Library
Open Library TV News
TV News Understanding 9/11
Understanding 9/11